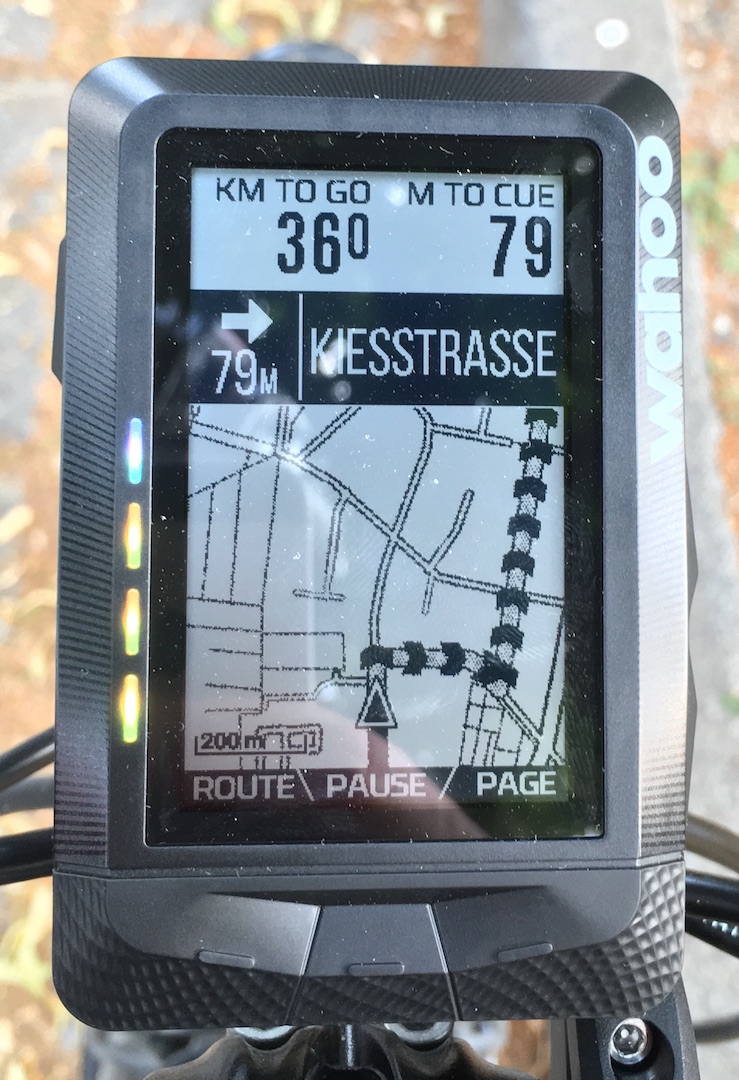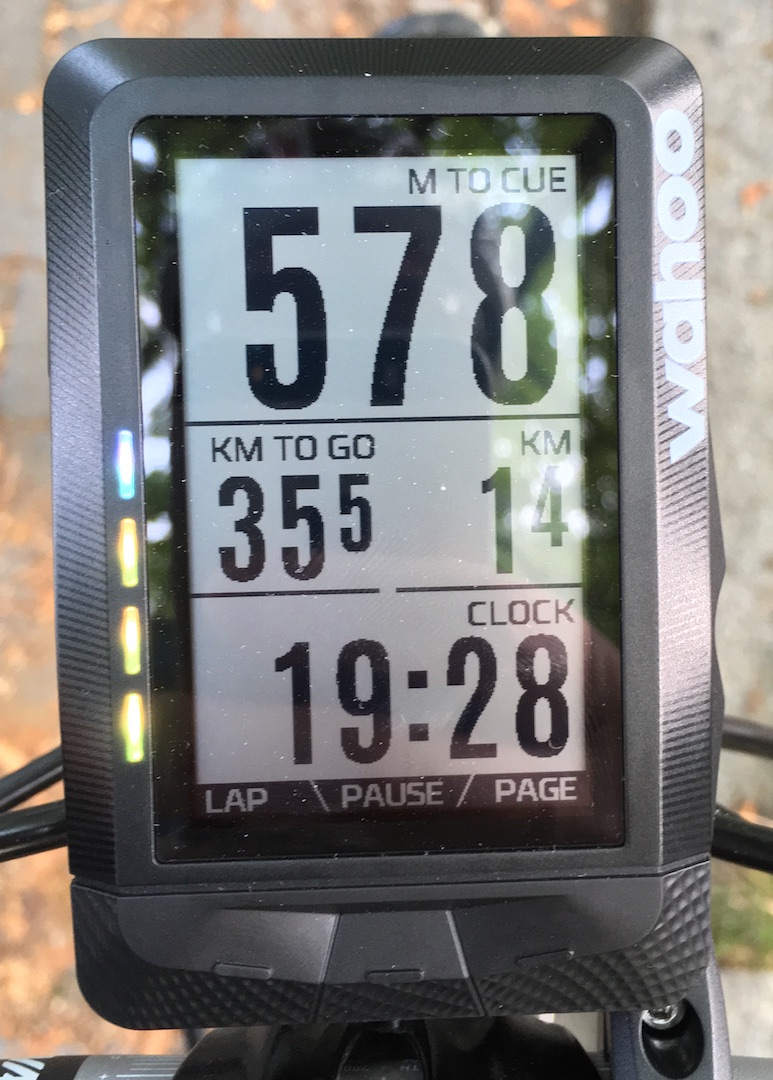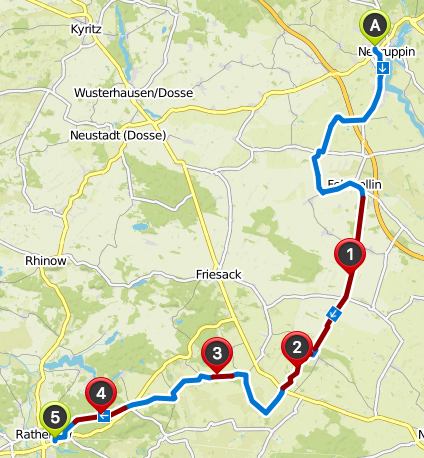Horizon Zero Dawn war mein Spiel der PS4-Generation. Ich habe 150 Stunden in dieser Welt verbracht. Ich bin über Berge geklettert, habe an Flüssen Sonnenuntergänge angeschaut und stand im Mondschein unter Palmen. Ich habe jeden Quest erledigt und jedes Item gefunden. Nicht weil ich musste, sondern weil ich wollte. Kein anderes Spiel habe ich so lange und so intensiv gespielt und war dabei so glücklich und zufrieden.
Macht mich Forbidden West so glücklich wie Zero Dawn? Die kurze Antwort: Nein. Zero Dawn war für mich gut, weil es viele Dinge weg ließ. In Forbidden West wurden alle diese Dinge hinzugefügt. Jede RPG-Mechanik, die dem Spiel ein Zwangsverhalten aufdrückt und die in Zero Dawn fehlte ist nun vorhanden. Und ich frage mich: Weshalb? Ihr habt sie doch absichtlich in Zero Dawn weg gelassen!
Aber zuerst zum Positiven: Die grafische Gestaltung aus dem ersten Spiel (Lens Flare, Wetter, Tag/Nacht-Wechsel, viel Natur im Stil von Casper David Friedrich) wurde beibehalten, aber neue Pflanzen und Landschaften und Klimazonen hinzugefügt. Forbidden West sieht im Resolution-Mode wirklich toll aus. Gerade die Charaktere, deren Haut, ihre Gesichter und Lippenbewegungen sehen filmreif aus (Realfilm!). Ebenso beim Wasser in Flüssen: Grandios! Gratulation auch an das Team von Stadt der Utaru, die wirklich etwas anderes als die üblichen Hütten ist. Die gute Grundlage ist also ebenso vorhanden wie im ersten Spiel.
Schlechte Stimmung macht sich aber bereits zu Beginn breit: Zero Dawn besaß ein fantastisches Intro (Aloys Kindheit als Outcast, der Fund des Focus, die Einführung in die Welt durch Rost, gefolgt vom der ersten kleinen Open World). Es fühlte sich nicht nur natürlich an, sondern stellte eine tiefe emotionale Verbundenheit mit den Charakteren her. Forbidden West ist ähnlich aufgebaut: Recap Movie, Einführung in die Spielsteuerung (inkl. Recaps), Fortführung der Handlung von Hades (inkl. Recap), kleine Open World. Diese vier Module folgen aufeinander, erweitern sich aber nicht und bieten keine derartig tiefen emotionalen Bezugspunkte.
Zero Dawn schaffte es, ein großes Geheimnis anzubieten und die Neugier zu steigern. Man wollte raus in die Welt, alles verstehen und lösen. Mindestens wollte man Meridian sehen, von dem alle ständig schwärmten! In Forbidden West ist alles Mittel zum Zweck: Man muss hier durchreisen, um anschließend dasselbe Problem wie in Zero Dawn zu lösen. Kein Geheimnis, welches mich zu sich zieht. Keine intrinsische Motivation.
Technisch kämpft Forbidden West außerdem mit deutlichen Problemen. 30 Frames in 4K wirken wie ein Daumenkino, in 1080p wird es besser. Der Performance-Modus mit 60 Frames ist aufgrund seines unruhigen Bildes unspielbar (Version 1.000.6). Der Workaround: Konsole auf 1080p einstellen, 30 Frames aktivieren und den TV das restliche (dann geringe) Daumenkino per Zwischenbildberechnung herausrechnen lassen. Wir sind also mit Forbidden West auf der Next Gen-Konsole dort angekommen, wo Zero Dawn auf der PS4 Slim war. Auch etliche andere Fehler fallen auf: Abgehackte Musik, in der Luft schwebende Klettermarkierungen, Loot Meter entfernt vom Loot aufsammeln, abbrechende Musik, flatternde Beine, flackernde Pflanzen, beim Klettern stecken bleiben, durch Steine laufen, fehlende Taschenlampe, abgeschossene Ressourcen bleiben in der Luft schweben usw.
Dass sich in der ersten kleinen Open World dennoch weitgehend das Horizon-Feeling einstellt liegt an der fantastischen Welt, die hier abermals geschaffen wurde. Wie in Zero Dawn macht es Spaß, diese Welt zu erkunden. Sie ist abwechslungsreich, hübsch und flexibel darin, wie ich mich in ihr bewegen möchte. Dass die Horizon-Formel auch weiterhin in Forbidden West funktioniert zeigt, wie stark sie ist, denn Forbidden West führt, wie eingangs erwähnt, viele Änderungen ein, die Freude und Flexibilität ersticken.
Was wurde schlechter?
Story
Es ist schwer, eine Story wie die in Zero Dawn zu toppen: Das Geheimnis um einen selbst und die gesamte Welt lüften und die Welt retten. Bereits Frozen Wilds konnte in mir nicht mehr diese intensive Motivation erzeugen, denn dort ging es nicht mehr um mich, sondern die Probleme anderer. Forbidden West schafft es ebenfalls nicht, steht sich dabei zudem gerne selbst im Weg herum. Wer der Hauptstory folgt wird nicht nur durch viele Side Quests abgelenkt (meist "töte Dinge" oder "hole Jenes"), sondern auch ständig behindert. Türen öffnen sich nicht mehr einfach so, sondern erfordern Gegenstände. Fetch Quests. Seufz. Nichts ist frustrierender, als in der Haupt-Story vor der großen Tür zu stehen, nur um von dem Spiel, dass mich hinführte, wieder weg geschickt zu werden.
Inventar & Loot-Boxen
Das Inventar in Zero Dawn war begrenzt. Die einzelnen Taschen ließen sich erweitern, aber irgendwann stoß man an ihre Grenzen. Zwar musste niemand Gepäck-Tetris spielen, aber man musste strategisch überlegen, was man verkaufen, behalten und was man aus Loot-Boxen mitnehmen möchte. Für mich fühlte sich das sehr natürlich an, denn in meinem Rucksack passt auch nicht die gesamte Welt.
In Forbidden West besitzt Aloy einen Stash. Dabei handelt es sich um eine unsichtbare Truhe, die sie beständig begleitet. Die Innenmaße dieser Truhe haben nichts mit ihren Außenmaßen gemein: Sie kann beliebige Mengen an Dingen aufnehmen und sortiert zur Verfügung stellen. Aloy wirft automatisch alles in diese Truhe, sobald ihr eigenes Inventar voll ist. Die Truhe wird in Siedlungen sichtbar und dort kann der Inhalt der Truhe das eigene (begrenzte) Inventar wieder auffüllen.
Holy Shit: In der komplett unmagischen Welt von Horizon wurde die Truhe aus den Scheibenwelt-Büchern abgelegt. Vorbei ist es mit dem völlig natürlichen Vorgehen, ab und zu das Inventar zu entschlacken, stattdessen dürfen wir uns nun komplett zumüllen und immer alles aufsammeln!
Folgerichtig ist die Welt vollgestellt mit Loot-Boxen. Im ersten Bandit Camp in No Man's Land erfasst der Focus alleine acht Boxen, weitere folgen tiefer im Camp. Daneben gibt es noch Autos, in deren Kofferraum sich Zeug befinden kann usw. Jeder Guide für Forbidden West empfiehlt, ständig alles zu looten. Das Ergebnis: Sammelwahn. Ohne Freude sammelt man jeden Mist auf – man könnte ihn ja irgendwann einmal gebrauchen, für die vielen nervenden Fetch Quests zum Beispiel. Es gibt sogar eine Option, mit der ALLE Komponenten einer toten Maschine gelootet werden können, damit man sich noch mehr zumüllen kann.
Dabei muss man weiterhin manuell alles einsammeln. Jede Loot-Box. Jeden Baum. Jede Maschine. Jedes abgeschossene Teil. Alles. Nicht einmal nach einem Kampf gibt es die Möglichkeit, alles Herumliegende auf einmal aufzunehmen. In Zero Dawn war dies aufgrund des begrenzten Inventars eine sinnvolle Einschränkung, in Forbidden West ist es nur eine weitere dröge Tätigkeit.
Skills
Skill Tree
Zero Dawn besaß einen linearen Skill Tree, den die meisten Spieler am Ende vollständig ausgefüllt haben werden. Damit war es weiterhin offen, wie sie spielen möchten, aber sie waren überall aufgelevelt. Forbidden West führt nun echte Bäume ein, inklusive Abhängigkeiten der Skills untereinander. Man kann sich seine Spielweise gezielt konfigurieren, muss dies aber auch machen und sich mit dieser Komplexität auseinander setzen. Als Stealth-Bogenschütze mit aufgerüsteten Melee-Funktionen und viel Schutz vor Angriffen muss ich in jedem Baum recht tief hinab und die Abhängigkeiten auflösen. Es nervt.
Kleidung
Neben Kleidungsstücken, die mit Coils erweitert werden können, sind Kleidungsstücke nun auch an Skills gebunden. Hier müssen folglich die Zusammenhänge beachtet werden.
Essen
Die für mich absurdeste Erweiterung: Man kann in Siedlungen essen und dieses Essen pusht bestimmte Skills für drei (3!) Minuten. Wer kostenlos essen möchte kann sich vom Koch eine Aufgabe abholen. Yay.
Wir haben somit insgesamt ein Abhängigkeitsgefüge aus Skills, Kleidung, Coils und Nahrung. Wir gewinnen dadurch nichts, verlieren aber Zeit und Spielspaß, denn wo Zero Dawn uns frei von der üblichen RPG-Spiellogik hielt ist sie in Forbidden West komplett vorhanden.
Erkundung
Zero Dawn war weitgehend offen. Es war evt. nicht schlau, irgendwohin zu gehen, aber es war meist möglich. Vereinzelt gab es eine Sperre für einen für später durch die Story relevanten Bereich, den man noch nicht betreten konnte. Forbidden West führt selbst in der Einführungswelt Bereiche ein, die nur mit bestimmtem Werkzeug erreicht werden können. Auch manche Tallnecks sind gesperrt. Aus dem spaßigen Rätsel, einen Tallneck zu besteigen, wird nun ein dröger Fetch-Quest. Die freie Erkundung stößt deutlich häufiger auf die Verweigerung des Spiels. Forbidden West ist eine riesige, hübsche Welt, fühlt sich aber durch die Spielzwänge kleiner und eingeschränkter an als Zero Dawns Welt.
Bandit Camps
Es deutete sich bereits in Frozen Wilds an, dass Bandit Camps "anders" werden. Etwas schlauer, aber vor allem etwas verbauter. Ich habe es genossen, mit aufgerüstetem Bogen um ein Camp herumzuschleichen, den richtigen Winkel zu erwischen und so Stück für Stück ohne Melee-Kämpfe die Camps zu leeren. Nicht so in Forbidden West: Die Camps sind kaum einsehbar. Irgendwann muss man rein. Liegt ein Camp neben einem kleinen Berg, so wurden dort nicht einmal die Klettermöglichkeiten angebracht, um sich in eine hohe Position bringen zu können. Meine bevorzugte Spielweise aus Zero Dawn: Nur noch schwer möglich.
Tripcaster
Das hier erwischte mich inmitten einer Side Mission: Es gibt nicht nur wie in Zero Dawn eine Begrenzung in der Anzahl der Fallen, die man mitführen kann, sondern auch in der Anzahl, die man aufstellen darf. Das lässt sich durch Skills erweitern, erfordert aber wiederum, dass zwangsweise Side Missions ausgeführt werden müssen, um mehr Skill Points zu erhalten. Don't give your users shit work.
Being able to deploy more traps at a time in Horizon Forbidden West is pretty simple. In the Trapper portion of the Skills menu is an entry titled Trap Limit. This Passive Boost has two levels to it. The first level can be purchased early in the game down the left portion of the skill tree, with the second level being at the very bottom. After buying both, you will be able to have up to four traps in the field at a time. (gamepur)
Vista Points
Diese Freudlosigkeit zieht sich durch weitgehend alles im Spiel, so auch durch die Vanish/Vista Points. In Zero Dawn war die Position eines solchen Points grob auf der Karte markiert und man musste ihn suchen, wurde dort anschließend durch eine Loot Box belohnt (Freude!), konnte sich das Bild anschauen (Freude!) und bekam Hintergrundstory (die die Welt größer machte!).
In Forbidden West macht sich ein Point durch ein Signal bemerkbar (keine Erkundung erforderlich, somit kein Erfolgserlebnis). Dort angekommen nimmt man den Datenpunkt auf, der leider defekt ist (Frust). Anschließend muss man den Aufnahmepunkt herausbekommen (nerviges Overlay-Puzzle) und wird dort mit dem vollständigen Bild belohnt (Freude), nicht aber mit einer sinnvollen Story (Enttäuschung). Eine Loot Box erhält man nicht, dafür kann man sich aber mit ziemlich fürchterlichen Rätseln (inkl. Handkarren) durch alte Gebäude bewegen und findet dort Dinge.
Das rein auf Neugier, Erkundung und Belohnung ausgerichtete System wurde komplex gemacht, aufgeteilt in Teilaufgaben. Was auf der Strecke bleibt ist die Motivation.
Craften
Aloy konnt in Zero Dawn überall craften. In Forbidden West geht dies für alles außer Munition nur an speziellen Workbenches, zu denen man hinlaufen muss. Aloy kann also im Gefecht gemütlich eine Explosivmunition zusammen bauen, aber nicht auf der Wiese stehen und ihren Potions-Beutel größer nähen. Forbidden West nimmt auch hier eine Freiheit, die einem Zero Dawn gab.
Klettern
Klettern war in Zero Dawn nur an definierten Routen mit gelben Markierungen möglich. Man konnte zwar geschickt durch Berglandschaften hüpfen und ich habe das viele freudige Stunden lang gemacht, gedacht war es aber nicht so. In Forbidden West können nun manche (nicht alle!) Berge erklommen werden: Mit dem Focus schaltet man unsichtbare Wegmarkierungen frei, an denen sich Aloy entlang hangeln kann, was eher holprig funktioniert. Häufig blieb ich irgendwo stecken, weil Aloy nicht greifen möchte, obwohl es gelb leuchtet. Diese Markierungen gelten zudem nur für manche Gebirge und Hügel und scheinen automatisiert gesetzt worden zu sein. Man findet sie z.B. an kleinen Felsen, auf die man springen kann, aber auch am Gebirge am Ende der Map: Man klettert neugierig den Berg hoch um an Ende vor dem Hinweis zu stehen, dass hier die Map zuende sei… Diese von vielen geforderte Möglichkeit, frei klettern zu können, ist in ihrer Umsetzung folglich schlechter als das Herumhüpfen in Zero Dawn. Dort fühlte es sich nämlich durchaus stimmig an: Es war steil, rutschig, nicht überall gab es Halt. Man hüpfte herum und testete den Untergrund. In Forbidden West hängt man nun an einem für das Klettern gesetzten Markierungspunkt und kommt nicht weiter, weil Aloy den nächsten nicht greifen möchte…
Die generierte Landschaft

Die Automatismus, mit dem die Landschaft generiert wurde, erzeugt in Forbidden West häufiger skurrile Dinge: Loot-Boxen hinter Büschen (die Aloy dann im Kopf hat) oder Pflanzen in Pflanzen oder Lagerfeuer in Pflanzen begegnen einem überall. Ich erwarte nicht, dass die Tester:innen jeden Zentimer des Spiels ablaufen, aber dies sind feste Orte. Wenn ich dort ankomme und diese Fehler sehe, werden dies auch Tester:innen gesehen haben. Und weshalb kann ich durch Bäume und Steine laufen? Weshalb versinken Steine im Boden? Wie groß ist wohl die Fehlerliste, die intern noch bei Guerrilla auf Abarbeitung wartet?
Was wurde besser?
Nach all dem Gemeckere stellt sich die Frage, ob Forbidden West überhaupt etwas besser macht als Zero Dawn und die Antwort lautet leider: Kaum. Man kann sich hinsetzen und die Tageszeit vorspulen, was bei manchen Angriffen helfen kann. Und man kann fliegen! Ansonsten wurde alles komplexer, subjektiv für mich dadurch aber schlechter.
Fazit
Der Vergleich zwischen Zero Dawn (1 Jahr nach Release) und Forbidden West (1 Woche nach Release) ist kein fairer: Das Spiel ist noch voller Bugs. Meine Hauptkritik bezieht sich deshalb auf die schlechtere Story und die erhöhte Komplexität. Ich fühle mich durch die neuen Spielmechaniken eingezwängt. Ob dieses Gefühl weg gehen wird, wenn ich weiter voran schreite, mich aufrüste und alle Elemente beisammen haben, die aktuell Wege blockieren, wird sich zeigen.
Wertung
- Zero Dawn: 10/10
- Frozen Wilds: 7/10
- Forbidden West (die ersten 20 Stunden mit 1.000.6): 6/10